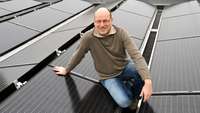Repowering: Damit die Windkraft bei Atem bleibt
Ersatz und Modernisierung bestehender Anlagen weiterhin vor vielen HürdenProbleme in der Praxis
So sinnvoll der Ansatz des Repowering ist: In der Praxis stehen die Betreiber vor verschiedensten Hürden, wenn sie bestehende Windkraftanlagen modernisieren möchten. Beispielhaft stellen wir hier einige der zahlreichen Fälle vor, von denen die DIHK erfährt. Vergleichbare Hindernisse finden sich an vielen Orten in Deutschland.
DIHK-Papier Repowering
Die Lösungsvorschläge der IHK-Organisation
Das größte Hindernis für Neuinvestitionen an Windenergiestandorten ist die Flächenausweisung: Sehr viele der bestehenden Anlagen in Deutschland werden unabhängig von möglichen Naturschutzkonflikten oder sonstigen Herausforderungen nicht ersetzt, weil sie außerhalb von später geschaffenen Windeignungsgebieten stehen und deshalb kein Baurecht besteht.
Ein Repowering sollte auch für solche Anlagen leichter möglich sein, da es sich um Standorte handelt, die bereits von der Windenergie geprägt sind. Es sollte daher eine Flexibilisierung der strikten Flächenbindung für diese Vorhaben geprüft werden. Diese Flexibilisierung des Standortes würde der technischen Entwicklung der Windenergieanlagen Rechnung tragen, welche immer höher werden und damit mehr Abstandsfläche zu bereits bestehenden Anlagen benötigen.
Dass Neuinvestitionen an Standorten von Windkraftanlagen anstehen, ist für eine Kommune meist frühzeitig absehbar. Zum Ende des Förderzeitraums stellt sich für fast alle Anlagenbetreiber die Frage, wie sie wirtschaftlich und technisch mit den Windrädern weiter verfahren können.
Daher ist es ratsam, rechtzeitig das Thema Repowering im Rahmen eines (örtlichen oder überörtlichen) städtebaulichen Konzepts aufzugreifen. Dieses kann dann als Grundlage für die planerische Absicherung durch Instrumente des Bauplanungsrechts verwendet werden. Die Länder, in denen frühzeitig in Windkraft investiert wurde und in denen sich deshalb die Repowering-Fälle häufen, sollten Hinweise zur Erstellung solcher Konzepte geben und darauf hinwirken, dass diese frühzeitig, zugeschnitten auf die örtlichen Verhältnisse, erstellt werden.
Innerhalb eines Radius von 3 Kilometern um ein Drehfunkfeuer ist die Errichtung einer Windkraftanlage verboten. Zwischen drei und 15 Kilometern trifft das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) auf Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung eine Einzelfallentscheidung. Nach internationalen Vorgaben liegt der Radius jedoch bei nur zehn Kilometern. Hier sollte geprüft werden, ob von der momentan geltenden Regelung nach unten abgewichen werden kann. Dadurch müssten viele Repowering-Projekte nicht mehr vom BAF geprüft und im Einzelfall entschieden werden.
Mit der neuen Regelung des § 16 b BImSchG wird das Genehmigungsverfahren sowie der Prüfungsumfang für Repowering-Anlagen erstmals ausdrücklich geregelt: Im Rahmen einer Änderungsgenehmigung werden nur Anforderungen geprüft, soweit durch das Repowering im Verhältnis zum Ist-Zustand unter Berücksichtigung der auszutauschenden Anlage nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden und diese für die Prüfung nach § 6 BImSchG erheblich sein können (sogenannte Delta-Prüfung).
Die neue Regelung umfasst dabei unter bestimmten Voraussetzungen auch ausdrücklich den gesamten Austausch einer Anlage. In diesem Fall muss die Anlage innerhalb von 24 Monaten nach dem Rückbau der Bestandsanlage errichtet sein und der Abstand zwischen Bestandsanlage und der neuen Anlage darf nicht mehr als das Zweifache der Gesamthöhe der neuen Anlage betragen. Allerdings bleibt die Prüfung anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften, insbesondere des Raumordnungs-, Bauplanungs- und Bauordnungsrechts und des Artenschutzes unberührt. Hier sollte überprüft und gegebenenfalls evaluiert werden, ob weitere Erleichterungen und damit Beschleunigung möglich sind, insbesondere mit Blick auf die bereits erwähnten Aspekte der Flächensicherung und des Bauplanungsrechts.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung von Genehmigungen ist die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung. Für die Planungspraxis insgesamt und damit auch bei Änderungsgenehmigungsverfahren für Repowering-Anlagen ergäbe sich eine erhebliche Entlastung, wenn ein bereits vor der Zulassungsentscheidung liegender Stichtag als maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage bestimmt werden könnte.
Als maßgebliche Zäsur könnte das Datum der Einreichung der Antragsunterlagen gelten. Dies könnte zumindest für alle Belange mit Ausnahme des Habitatschutzrechts ((92/43/EWG) (FFH-Richtlinie)) und der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) gelten, nach denen die Verträglichkeitsprüfung eine "Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse" erfordert.
Bisherige Maßnahmen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Immissionsschutzrecht (BImSchG) entfalten ihre Wirkung in der Praxis nicht, weil Klarstellungen nicht abschließend behandelt wurden und Vollzugsvorgaben der Länder fehlen. Wichtig sind daher verbindliche Leitfäden des Bundes für die Behörden bereitzustellen.
Darüber hinaus können verbindliche Genehmigungsfiktionen bei der Anlagengenehmigung, eine Stichtagsregelung für die Sach- und Rechtslage, klare Anforderungen an die Vollständigkeit der Antragsunterlagen und eine stärkere Rolle der Projektmanager das Repowering und den Ausbau der Windkraft beschleunigen.
Nach Angaben von Unternehmen sind heute immer noch viele Zulassungsverfahren überwiegend analog: Anträge müssen immer noch in mehrfacher Ausfertigung unterschrieben und postalisch an die zuständigen Behörden gesendet werden. Diese kontaktiert in der Regel postalisch beteiligte Behörden. Die Bescheide werden dann per Post an die Vorhabenträger gesandt, die wiederum beteiligte Unternehmen (beispielsweise Planer und Kontraktoren) unterrichten müssen.
Wir schlagen deshalb vor, dass alle Unterlagen elektronisch eingereicht werden und auch so unter den Behörden ausgetauscht werden sollten. Um ein vollständig digitales Verfahren zu gewährleisten, sollten alle Unterlagen des Verfahrens über ein zentrales Internetportal abgewickelt werden. Hier sollte geprüft werden, ob mit dem Länderportalverbund bereits ein Single Digital Gateway (SDG) genutzt werden kann. Dies würde das Verfahren erheblich beschleunigen, Repowering erleichtern und damit auch die Ausbauziele der Bundesregierung für erneuerbare Energien unterstützen.
Der Fristbeginn zur Zulassung von Windkraftanlagen hängt wesentlich von der Vollständigkeit des Antrags und der beizubringenden Unterlagen ab. Dies führt in der Praxis häufig dazu, dass bereits vor der Bestätigung der Vollständigkeit mehrfach Unterlagen nachgefordert werden. Um dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung nachzukommen, sollte das Verfahrensrecht folgendermaßen angepasst werden:
- Unterlagenkatalog definieren:
Zur geplanten Pflicht der Veröffentlichung eines Verfahrenshandbuchs für die Genehmigung von EE-Anlagen sollte den zuständigen Behörden aufgegeben werden, die dafür notwendigen Unterlagen detailliert aufzulisten. Dies würde viele Nachfragen vermeiden und den Aufwand bei Unternehmen und Behörden verringern. Hierzu finden sich in den Bundesländern bereits zahlreiche Beispiele. Um einen bundesweiten Standard für die notwenigen Unterlagen zu schaffen, sollte ein Beispielkatalog geprüft werden. Diese Vorgaben sollten allerdings möglichst fakultativ ausgeführt werden, um fachkundigen Behörden in Absprache mit den Vorhabenträgern sinnvolle Abweichungen zu gewähren. Unternehmen schlagen hierzu eine mögliche Antragskonferenz vor, wo Unterlagen und Zeitplan mit dem Vorhabenträger und beteiligten Behörden abgesprochen werden können.
- Umfang der Nachforderungen vorgeben:
Aus der Praxis berichten Unternehmen, dass die Verfahren immer wieder aufgrund mehrfacher Nachforderung von Unterlagen durch beteiligte Behörden verzögert werden. So werden nach einer erstmaligen Nachforderung häufig erneut zusätzliche Unterlagen nachgefordert. Nachforderungen sollten nach Eröffnung des Verfahrens nur einmal mit einem klar formulierten abschließenden Nachforderungskatalog zugelassen sein.
- Fiktion für die Vollständigkeitserklärung einführen:
Unternehmen berichten auch, dass die Fristen zur Vollständigkeitsprüfung von Behörden teilweise unbegründet überschritten werden. Damit die Genehmigungen tatsächlich innerhalb der Fristen erfolgen können, sollten die Fristen in diesem Zusammenhang durch eine Fiktion ergänzt werden. So sollten WHG und BImSchG vorgeben, dass die eingereichten Unterlagen als vollständig gelten, wenn die zuständige Behörde die Vollständigkeit der Unterlagen nach vier Wochen nicht bestätigt und dafür keine Begründung abgegeben hat. Zusätzlich sollte sichergestellt werden, dass eine dann etwaig gegebene Unvollständigkeit der Unterlagen nicht zulasten der Unternehmen gehen kann.
Im Jahr 2022 hatte die Windkraft einen Anteil von 24,1 Prozent an den 509,4 Milliarden Kilowattstunden, die in Deutschland ins Stromnetz eingespeist wurden.
GemeinsamMehrUnternehmen